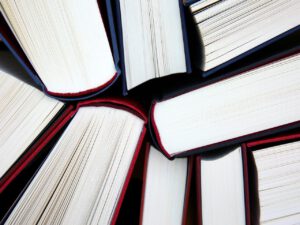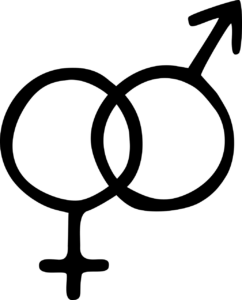Befangenheitsanträge sind bei Gericht nichts Ungewöhnliches. Gerade im Bereich des Strafrechts kann es immer mal wieder dazu kommen, dass der Angeklagte der Meinung ist, das Gericht habe gegen ihn persönlich irgendwelche Abneigungen, sodass eine Ablehnung des Gerichts wegen Befangenheit naheliegt. Aber was passiert, wenn die Staatsanwaltschaft das Gefühl hat, das Gericht sei nicht objektiv? Nunmehr hat der BGH entschieden, wie in so einer Situation zu verfahren ist.
Bei den gesetzlichen Vorschriften, nach denen ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden kann (§ 24 Abs. 1 und 2, § 31 StPO), handelt es sich nicht um Rechtsnormen, die im Sinne des § 339 StPO lediglich zugunsten des Angeklagten wirken. Die Staatsanwaltschaft kann in Ausübung ihrer Rolle als „Wächterin des Gesetzes“ Rechtsfehler im Zusammenhang mit der Entscheidung über von ihr gestellte Ablehnungsgesuche ungeachtet von deren Angriffsrichtung mit der Revision rügen. Ein Ablehnungsgesuch der Staatsanwaltschaft ist gerechtfertigt, wenn sie bei verständiger Würdigung der ihr bekannten Umstände Grund zu der Besorgnis hat, dass der Richter gegenüber dem rechtlich zu würdigenden Sachverhalt oder den daran Beteiligten nicht unvoreingenommen und unparteilich ist.
Der Sachverhalt
Das LG hat den Angekl. wegen „Beihilfe zur tateinheitlichen Einfuhr von und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt und eine Einziehungsentscheidung getroffen.
Das zu Lasten des Angekl. eingelegte, vom Generalbundesanwalt vertretene und auf die Rügen der Verletzung formellen und materiellen Rechts gestützte Rechtsmittel der StA hat mit der Verfahrensrüge Erfolg. Ihr liegt folgendes Verfahrensgeschehen zugrunde:
Die an dem angefochtenen Urteil mitwirkende Schöffin J teilte dem Vorsitzenden am ersten Hauptverhandlungstag nach Verlesung der Anklage mit, dass es sich bei dem Angekl. um den ehemaligen Partner ihrer „angeheirateten Nichte“ handele, den sie auf Familienfeiern fünf- bis sechsmal getroffen und mit dem sie sich auch unterhalten habe. Die Beziehung zwischen der „Nichte“ und dem Angekl. sei beendet, ihr letzter persönlicher Kontakt zum Angekl. sei über drei Jahre her. Nach Bekanntgabe dieser Umstände durch den Vorsitzenden gegenüber den Verfahrensbeteiligten erklärte der Verteidiger des Angekl., dass das im Anklagesatz erwähnte Tatfahrzeug, der Opel Corsa, der „Nichte“ gehöre, diese aber nicht gewusst habe, wofür der Angekl. sich das Fahrzeug geliehen habe.
Nach einer circa fünfundvierzigminütigen Sitzungsunterbrechung verlas die Sitzungsvertreterin der StA ein gegen die Schöffin gerichtetes Ablehnungsgesuch und begründete dieses mit deren „Verwandtschaftsverhältnis“ zur Eigentümerin des mutmaßlichen Tatfahrzeugs. In ihrer sich anschließenden dienstlichen Äußerung bestätigte die abgelehnte Schöffin, dass die durch den Vorsitzenden vorgetragenen Tatsachen zu ihrer Bekanntschaft zum Angekl. zutreffend seien.
Die Strafkammer hat den Ablehnungsantrag zurückgewiesen und zugleich die Selbstanzeige der Schöffin als unbegründet erachtet. Sie hat ausgeführt, dass mangels enger persönlicher Beziehung der Schöffin zum Angekl. eine Besorgnis der Befangenheit nicht bestehe.
Die Entscheidung des BGH
Die Beschwerdeführerin beanstandet zu Recht die Mitwirkung der erkennenden Richterin. Zwar kann das Revisionsgericht in den Fällen des § 30 StPO die Entscheidung, durch welche die Selbstanzeige eines Richters oder Schöffen wegen eines Verhältnisses, das seine Ablehnung rechtfertigen könnte, für begründet oder für nicht begründet erklärt wird, für sich gesehen grundsätzlich nicht überprüfen. Der absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 3 StPO betrifft lediglich den Fall der Ablehnung nach § 24 StPO, nicht den der Selbstanzeige nach § 30 StPO. Anderes gilt aber dann, wenn sich – wie hier – ein Ablehnungsberechtigter das Vorbringen des Selbstanzeigenden zu eigen macht und ihn deswegen ablehnt; dies eröffnet das Verfahren der §§ 25 bis 28 StPO. Dementsprechend hat die Strafkammer mit der Entscheidung über den gegen die Schöffin gerichteten Befangenheitsantrag zugleich über die Selbstanzeige der Schöffin befunden.
Der Rüge steht § 339 StPO nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift kann die StA zwar die Verletzung von Rechtsnormen, die lediglich zugunsten des Angekl. gegeben sind, nicht zu dessen Nachteil geltend machen; doch trifft das für die hier in Rede stehende Rechtsnorm (§ 24 StPO) nicht zu.
Die höchstrichterliche Rspr. hat sich bislang allein mit der Frage befasst, ob die Gesetzesbestimmungen, nach denen ein Richter von Gesetzes wegen an der Mitwirkung an der Entscheidung ausgeschlossen ist, lediglich zugunsten des Angekl. iSd § 339 StPO gegeben sind und dies für § 22 StPO verneint. Für die gesetzlichen Vorschriften, nach denen ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden kann (§ 24 Abs. 1 und 2, § 31 StPO), gilt nichts Anderes. Diese Rechtsnormen dienen nicht allein den Verteidigungsbelangen des Angekl. und damit nicht allein seinem Schutz, sondern bezwecken, das Gebot eines unabhängigen und unparteilichen Richters zu garantieren.